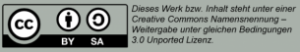Seit fast vier Monaten ist der 21. Bundestag im Amt, der Kanzler vereidigt – im zu vorigen Wahlkampf war zu spüren, dass sich die politische Kommunikation im Netz verändert: die Social Media Plattform TikTok spielte eine ungewohnt große Rolle. Denn mittlerweile ist bekannt: der Algorithmus mag Radikalität, die Zuschauenden kurze Videos – beide präferieren Content, in dem viel passiert. Faktoren, die Politiker*innen unterschiedlichster Parteien nutzten, um junge Wähler*innen zu erreichen – mit teils hohem Aufwand, gemischtem Erfolg und nicht selten der Frage, wie viel Inhalt hinter der Inszenierung steckt. Nach dem Bundestagswahlkampf zeigte die App das Ausmaß ihrer Wirkung: Die Linke und die AFD profitierten sichtbar und Friedrich Merz wurde als @bundeskanzler zur viralen Figur.
Nach Regierungsbildung existiert nun mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung erstmals eine zentrale Instanz für die digitale Transformation. Dabei drängt sich die Frage auf, wie digital die Bundesministerien selbst sind. Welche Ressorts haben einen TikTok-Auftritt, wie aktiv sind sie, und wer wagt sich an ungewöhnliche Formate? Eine Analyse zeigt: Zwischen behördlicher Zurückhaltung und politischen Experimenten bleibt das Potenzial der Plattform weitgehend ungenutzt – nur das Auswärtige Amt mitsamt Johann Wadephul schaffen es, die Mechanismen der App erfolgreich für sich zu nutzen. Mit Folgen, die über Reichweitenzahlen hinausgehen.
Über Witze und Werbekampagnen
Im Beginn der neuen Legislaturperiode rückt ein Ministerium besonders in den Fokus der Öffentlichkeit: das neu geschaffene Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Ausgerechnet dort, wo der digitale Aufbruch beginnen soll, ist man auf TikTok bislang abwesend. Stattdessen füllt ein Satire-Account die Lücke: Unter dem Namen @digitalministerium erklären zwei junge Männer in ironischen Clips die vermeintlichen Aufgaben des Hauses – und bieten an, den Account „quasi als Geburtsgeschenk“ an die Bundesregierung abzugeben. Die Aktion bringt auf den Punkt, was derzeit für viele Ministerien gilt: Ihre Präsenz auf der Plattform ist so schwach, dass man ihnen dort sogar zuvorkommen – und sich gleichzeitig über sie lustig machen – kann. TikTok ist längst ein politisches Spielfeld. Die Institutionen aber stehen oft noch am Rand.
Sucht man aktuell nach offiziellen und aktiven Profilen der Ministerien, wird man nur in vier von sechszehn Fällen fündig.
Mit der TikTok-Kampagne Was ist Queer? bemüht sich das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (10.6K Follower*innen) queere Menschen sichtbarer zu machen und Akzeptanz zu stärken. In einem anderen Format wird leicht verständlich dargelegt, was Artikel im Grundgesetz konkret bedeuten und im Juni wurden innerhalb von vier Videos die Ziele und Werte der neuen Gesundheitsministerin Karin Prien (CDU) vorgestellt. Dass der Account unter dem Namen Jugendministerium zu finden ist, zielt vermutlich auf die zumeist sehr jungen TikTok Nutzer*innen ab. Der Content erreicht häufig ca. 2K Views und bleibt durchschnittlich bei unter 100 Likes. Auf dem Account des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (61.4K) berichten zurzeit Jugendliche aus einem Programm für Ausbildungsplatzbesetzung von ihren Erfahrungen. Die Videos sollen auf die Beratungsmöglichkeiten des Programms aufmerksam machen. Das Format wird von knapp 1K Nutzer*innen gesehen und von ca. 25 geliked. TikToks von Reden der Wirtschaftsministerin Katherina Reiche erreichen wesentlich mehr Aufmerksamkeit: um die 20K Views und ca. 1K Likes. Beim Bundesministerium für Gesundheit (154.5K) trat in den vergangenen 3 Monaten ausschließlich die zuständige Ministerin, Nina Warken, vor die Kamera. Sie grüßt von Reisen und Versammlungen und wird bei ihrem ersten Krankenhausbesuch begleitet – das hat zwischen 1- und 3K Views und bleibt ebenfalls bei unter 100 Likes.
Die drei Accounts weisen neben ihrem eher geringen Erfolg einige Gemeinsamkeiten auf: die Videos sind zwar professionell produziert, allzu oft auf den ersten Blick allerdings nicht als die der Ministerien erkennbar. Die Kampagne für queere Sichtbarkeit und die Reihe zur Ausbildungsplatzbesetzung könnten auch von Beratungsstellen oder Gesellschaftlichen Initiativen sein. Wenn dann Katherina Reiche in einem Krankenhaus lächelnd bei Gesprächen gefilmt wird, meint man eher man sehe einen Imagefilm als die Arbeit des BMG. Aber das ist schließlich, wofür TikTok da ist. Oder nicht? Eine weitere Werbeplattform, auf der politische Kommunikation so oberflächlich wie auf Instagram und so inhaltsleer wie auf Twitter (X) geführt werden kann?
Ein Beispiel, bei dem sich nicht nur erfolgreich der Atmosphäre von Schnelligkeit und Intensität auf der Plattform angepasst wird, sondern auch die Vorliebe des Algorithmus für Kontroverses bedient wird, ist der Content des Auswärtigen Amts.
Der Superheld der Außenpolitik
Außenminister Johann Wadephul hält, wie es auf TikTok üblich ist, zwischen Zeigefinger und Daumen ein kleines Mikrofon in Schachtelform. Ruhig, selbstbewusst, nah an der Kamera positioniert und ohne Jackett spricht er über das vergangene Außenminister-Treffen der NATO. Hochqualitative Kameraaufnahmen der Begegnung werden Zwischengeschnitten. Wadephul berichtet von den Handlungsvorschlägen des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte zum nächsten NATO-Gipfel – und er nimmt sich Zeit. Drei Minuten geht das Video, eine Länge, die über die typische Zeitspanne für TikToks hinausgeht. Ursprünglich mussten Clips auf fünfzehn Sekunden beschränkt sein, 2017 wurde es zu einer Minute, 2021 zu drei Minuten und mittlerweile ist eine Länge von bis zu einer Stunde möglich. Die TikToks der anderen Ministerien dauern meist durchschnittlich eine- bis zwei Minuten.
Doch das ist nicht das einzig ungewöhnliche: der Außenminister ist nämlich noch unterwegs, auf dem Rückflug des Treffens. Das Surren des Flugzeugs im Hintergrund ist Nebencharakter in vielen der Videos. Es wird auch kurz aus dem Fenster auf eine hell erleuchtete Stadt oder die Hand des Piloten, das Flugzeug bedienend, gefilmt. Die Machart der Videos gleicht dabei Trailern für Action- und Superheldenfilme.
Manchmal ist Wadephul auch mit dem Zug unterwegs. Ob er währenddessen Fragen aus den Kommentarspalten beantwortet oder Staatsbesuche in farbsatten Bildern zu epischer Musik inszeniert werden – die Bildsprache ist Bewegung. Auf einer Plattform, deren Währung Aufmerksamkeit ist, darf man nicht stillstehen. Dies wird hier nicht nur durch Bildsprache, sondern auch durch die Menge und Regelmäßigkeit von Videouploads kommuniziert. Er übertrumpft dabei die anderen Ministerien-Accounts bei weitem. Auch die Zahlen unterscheiden sich deutlich: obwohl sich beim BMG mehr Follower*innen zählen lassen und die Views schwanken, gibt es kontinuierliche Erfolge von 30K bis über 100K Views. Die Likes variieren ebenfalls, liegen jedoch bei 1K, mit manchen Ausreißern von 15K.
Zwischen sinnvoller Provokation und Menschenfeindlichkeit
Einer der besagten Ausreißer ist die Reihe „Ist russische Desinformation immer noch so verrückt?“. Der Außenminister eröffnet die Beiträge mit besagter Frage, infolgedessen ist ein, allen Anscheines nach, KI-generiertes Intro zu sehen. Der Titel der Reihe entfaltet sich zu einer Melodie mit gleichnamigem Text, der Akzent der Stimme soll wohl russisch sein. Im Hintergrund ein dem Kreml nachempfundener Gebäudekomplex. Darauf folgt z.B ein Clip von Vladimir Putin, in dem er Falschinformationen äußert. Schnitt zu Wadephul, während die anfängliche Frage unter ihm eingeblendet ist: „Ja!“.
Ich spreche darüber mit dem Politikberater Martin Fuchs. Er meint, er sei erst skeptisch gewesen und spricht von einer Grenze, die er nicht überschreiten wollte – der Dialekt sei kulturelle Aneignung. Man mache sich damit nicht nur über russische Menschen lustig, die hinter Putins Regime stünden. Doch seine Einschätzung habe sich in den vergangenen Wochen verändert. Es könne die richtige Strategie sein, auch im Kontrast zu den anderen, überwiegend seriösen Videos des Accounts: Vor allem wenn das Thema von klassischen Medien aufgegriffen würde: „Auch wenn man sich nur im Feuilleton über das Video lustig macht, es wird über russische Desinformation geredet.“.
Es scheint, als seien demokratische Kräfte in ein Rennen mit ihren antidemokratischen Gegner*innen verwickelt worden. Man überschlägt sich, stolpert und stößt auch – wenn es vermeintlich sein muss – Unbeteiligte um. Das Auswärtige Amt ist eigentlich, wie auch Martin Fuchs meint, eine diplomatische Instanz, eine Vertreterin demokratischer Werte ins Innen, doch vor allem nach außen. Vertreter*innen der Demokratie sollten auch mit untypischen, kontroversen Mitteln ihren Gegner*innen entgegentreten dürfen. In Zeiten des Erstarkens rechtsradikaler Ideologien sollten sie das sogar. Doch der Raum der Diplomatie und der Demokratie wird durch diese Video-Reihe verlassen. Man begibt sich in Gefilde die Ressentiments und Rassismus verstärken, das ist gefährlich. Umso gefährlicher ist es, dass es sich hier um eine staatliche Institution handelt, die sich herablässt auf etwas, gegen das sie eigentlich ankämpfen sollte: Menschenfeindlichkeit.
Die TikTok Accounts der deutschen Ministerien füllen eine Bandbreite von Content: sie bemühen sich in Aufklärung und Bildung, aber auch bei der Erstellung von Wahlwerbespots. Optional bieten sie kreative Blicke hinter die Kulissen oder Videos, die sich mindestens als provokativ bezeichnen lassen. Dabei wird das Potenzial der Plattform meistens nicht ausgeschöpft: die niedrigschwellige Begegnung mit den unterschiedlichsten Zuschauenden bietet Platz für persönlichere politische Kommunikation auf Augenhöhe. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Digitalministerium auf TikTok präsentieren wird. Bis dahin empfiehlt es sich die staatlichen Imagefilme auszuschalten – egal wo sie laufen.
Foto von amrothman auf pixabay
Text: CC-BY-SA 3.0