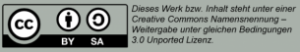ADHS wird nach wie vor überwiegend mit Jungen und Männern in Verbindung gebracht. Bei Mädchen und Frauen bleibt die Störung deshalb oft unerkannt oder wird fehldiagnostiziert – eine Wahrnehmung, die auch durch mediale Darstellungen begünstigt wird.
Da steht es nun, schwarz auf weiß: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Und ich bin vor allem eins: erstaunt. Ein paar Monate zuvor wurde mir der Verdacht von einer behandelnden Psychologin mitgeteilt. Auch das, zu meiner Überraschung. Ich hatte es einige Zeit vorher selbst vermutet und sogar einen Termin bei einem Psychiater gefunden. Dieser sprach fünfzehn Minuten mit mir, sah sich meine Grundschulzeugnisse an und konkludierte schließlich: es könne keine ADHS vorliegen, es scheine ich sei in der Schule konzentriert gewesen. Ich verließ die Praxis eingeschüchtert und beschloss mir keine Gedanken mehr darüber zu machen.
Bei meiner zweiten Diagnostik teilte man mir mit, dass Mädchen und Frauen mit ADHS unter anderem oft nicht diagnostiziert werden, weil sie weniger negativ auffallen, z.B. in der Schule. Das war ein Augenöffner. Trotzdem relativierte ich während der Anamnese sämtliche meiner Aussagen und Selbstbeschreibungen und verließ den Raum unsicher. Als ich den Befund in der Hand hielt, konnte ich es nicht glauben. Als ich es meinen Freund*innen erzählte, konnte ich es noch immer nicht glauben. Ich glaubte und verstand es erst, als ich begann die Geschichte der Diagnose zu recherchieren und die Berichterstattung zu analysieren und feststellte, wie eingeschränkt der mediale, gesellschaftliche und medizinische Blick auf ADHS lange war und noch immer ist.
Stereotypen und Gender Bias
Wie die meisten Menschen, bin ich mit einem sehr stereotypen Bild von ADHS aufgewachsen. Bereits in meiner Kindheit festigte sich das Bild vom im Unterricht störenden Jungen, der nicht stillsitzen kann, Lehrer*innen gegenüber frech oder sogar aggressiv ist und deswegen wahrscheinlich mindestens eine Klassenstufe wiederholen muss. Im Gegensatz zu diesen Stereotypen kann ADHS sehr unterschiedlich aussehen. Die Symptome müssen bereits im Kindesalter präsent sein, in mehreren Lebensbereichen auftreten und die Betroffenen im Alltag einschränken. Sie dürfen ebenfalls durch kein anderes Krankheitsbild erklärt werden. Hohe Impulsivität bzw. geringe Impulskontrolle, geminderte Aufmerksamkeit, aber starke Schübe von Hyperfokus bei Themen und/oder Aktivitäten, die von persönlichem Interesse sind, motorische Hyperaktivität & exekutive Dysfunktion, welche sich z.B. in Schwierigkeiten mit (Selbst-)Organisation oder Prokrastination zeigen können – doch das sind klinische Beschreibungen. Die Erfahrung von ADHS beschreiben Betroffene oft als einen konstanten Chaos im Kopf oder eine immerwährende Unruhe.
Der Grund für die teils zwar wahren, aber irreführenden Stereotypen und den damit einhergehenden, fehlenden Diagnosen bei Mädchen und Frauen liegt unter anderem in der Historie von ADHS.
Wissenschaftler*innen gingen lange davon aus, dass ADHS eine Störung ist, die nur im Kindesalter vorliegt und sich auswächst. Sie ist daher erst seit 1992 mit der damals aktuellen Version der International Classification of Diseases (ICD 10) bei Erwachsenen diagnostizierbar. Gegenstand der Forschung waren bis in die achtziger Jahre Kinder, und vor allem Jungen. Die Geschichte der Ausgrenzung von Frauen aus der medizinischen und psychiatrischen Forschung ist auch heutzutage ein großes Problem. Patriarchale Sozialisation und geschlechtsbezogene Vorurteile wie Erwartungen (Gender Bias) verändern sowohl die Präsentation als auch die Wahrnehmung von ADHS-Symptomen bei Mädchen und Frauen: sie internalisieren ihre Unruhe eher, sind besser in der Lage Verhalten zu kaschieren oder zu maskieren – sich sozial anzupassen. Sie neigen zu Höflichkeit und Zurückhaltung und behalten Probleme eher für sich. Die Erfahrung von der Norm abzuweichen wird schambehaftet, der Selbstwert leidet. Natürlich wird diese Erfahrung nicht nur von Frauen und Mädchen gemacht, generell hat ADHS eine hohe Komorbidität mit psychischen, wie physischen Krankheiten und Störungen. Kinder mit ADHS haben in bis zu 30% der Fälle eine Rechen- oder Leserechtschreibschwäche. Bis zu 50% der Erwachsenen mit ADHS leiden im Laufe ihres Lebens unter einer Depression oder einer Angststörung, auch Bluthochdruck ist dreimal so häufig. Das Stereotyp, nur Jungen oder Männer seien betroffen, teilt sich ADHS mit der Autismus-Spektrum Störung. Und nicht nur das, die beiden Diagnosen konnten bis 2013 nicht simultan gestellt werden, da man davon ausging, sie würden einander ausschließen. Mittlerweile ist dies widerlegt und Studien vermuten, dass die beiden eine hohe Komorbidität aufweisen können.
Ob anerzogenes Verhalten, gesellschaftliche Erwartungen oder Komorbiditäten, meistens wird eine ADHS als zugrunde liegende Problematik nicht erkannt, insbesondere bei Mädchen und Frauen. Aber wie passt das zu den aktuellen Debatten um die sogenannte „Modediagnose“ ADHS?
Über- oder Unterdiagnostiziert?
Egal ob in Artikeln, Podcasts oder Reportagen – momentan wird viel über ADHS berichtet und diskutiert. Im SWR Kultur Forum wurde erst Ende Juli die Frage gestellt, ob es sich bei der Diagnose um „eine Krankheit oder eine versteckte Begabung“ handle und in der Süddeutschen Zeitung spricht die Ärztin Astrid Neuy-Lobkowicz darüber, dass sie pro Monat 350 Anfragen zu einer Diagnostik bekäme. Oft kommt die Frage, oder gar Behauptung auf, es handle sich bei ADHS um eine Modediagnose.
Sieht man sich die Daten aus den 2000er und 2010ern an, lässt sich eine vermehrte Häufigkeit von Diagnosen feststellen. So stieg zwischen 2009 und 2014 laut einer Auswertung von Krankenkassendaten die Menge an Diagnosen bei 18–69-Jährigen von 0,2 auf 0,4 Prozent. Ebenso fand eine in der Cambridge University Press veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2023 einen Anstieg an ADHS-Diagnosen in fast allen Altersgruppen in den Jahren 2000 bis 2018 in England.
Eine andere aktuelle Studie im Journal of Affective Disorders konnte hingegen keinen Anstieg in der globalen Prävalenz von ADHS seit 2020 feststellen. Sie merkt ebenfalls an, dass es aufgrund der Covid-19 Pandemie und unzureichenden, hochqualitativen Studien zur Thematik schwer ist, aussagekräftige Ergebnisse zur Prävalenz von ADHS zu erzielen.
Was jedoch in den in den letzten zehn Jahren enorm anstieg, ist die mediale Aufmerksamkeit für ADHS: zwischen Januar und Mai 2014 wurden global 5.775 Artikel zu ADHS veröffentlicht, im gleichen Zeitraum 2024 waren es 25.080 Artikel.
Einsamkeit, trotz Aufmerksamkeit
Die größere gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit ermöglicht es Betroffenen einfacher an Informationen zur Störung kommen, somit beginnen bisherige Stigmata sich zu lösen und die Menge an Menschen, die vermuten unter ADHS zu leiden, steigt. Die Autor*innen der Studie des Journal of Affective Disorders vermuten dies ebenso. Somit verlängern sich Wartelisten, bis sie geschlossen werden – ein relevanter Aspekt der ohnehin bereits bestehenden medizinischen- und vor allem psychiatrischen Unterversorgung: Kosten müssen entweder vollständig oder teils selbst erbracht werden, nur eine Minderheit des medizinischen Fachpersonals ist auf ADHS spezialisiert und behandelt, wie bereits erwähnt, oftmals unter einem Gender Bias. Der Prozess zur Diagnose und Behandlung, wie z.B. durch Medikation ist dadurch stark erschwert, in den meisten Fällen dauert es Jahre von einem Verdacht bis zur Behandlung.
Von Verklärung und Veränderung
ADHSler*innen können durch ihre unkonventionelleren Denkweisen oft sehr kreativ und energiegeladen sein und besondere Problemlösungs-Kompetenzen aufweisen. Viele wollen diese Eigenschaften nicht missen und sich insbesondere nach einer späten Diagnose bestärken, ihr Sein frei und ohne Scham ausleben. Begleitet wird dies durch einen Perspektivwechsel, den Betroffene momentan zunehmend für sich schaffen. Statt ADHS als Störung zu bezeichnen, wird sie dem Konzept der Neurodivergenz zugeschrieben, dies lehnt an das wesentlich ältere, soziale Modell von Behinderung, welches theoretisiert, dass psychische oder physische Einschränkungen bzw. Behinderungen durch soziale und gesellschaftliche Umstände erst zu Einschränkungen werden. So sieht das Konzept der Neurodivergenz neurobiologische Abweichungen nicht als krankhaft, sondern als Teil menschlicher Vielfalt. Der Begriff ist nicht neu, bereits 1998 schrieb der Journalist Harvey Blume im Atlantic zu Neurodiversity. Im Spektrum der Neurodiversität liegen ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyskalkulie und Dyspraxie.
Sowohl das soziale Modell von Behinderung als auch Neurodivergenz werden von Betroffenen wie Wissenschaftler*innen diskutiert, insbesondere weil es Einschränkungen gibt, die Betroffene unabhängig von ihrer Umwelt beeinträchtigen. Die Konzepte werden allerdings auch als sinnvoll erachtet um psychiatrische, medizinische und gesellschaftliche Institutionen und Normen zu kritisieren und (Selbst-)Akzeptanz zu stärken.
Auch die Berichterstattung zu ADHS legt ihr Augenmerk auf diese Wandlung und die neu gefundene Bestärkung der Identifikation mit Neurodivergenz, interpretiert diese jedoch als „Hype“ um die Störung – eine fehlgeleitete Konklusion. Der Spiegel beschreibt in einem gleichnamigen, aktuellen Artikel „die neue Attraktivität“ der Diagnose. Dort liegt die Problematik; obwohl Betroffene ihre Erfahrungen mit ADHS zu leben, ADHSler*innen zu sein, von Scham befreien und positives darin sehen, vielleicht sogar Vorteile finden, lässt nicht darauf schließen, die Diagnose würde als etwas Begehrliches gesehen. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der aktuellen medialen Berichterstattung und Atmosphäre legen dies allerdings nahe. Man könne so weit gehen, es als neustes ADHS-Stereotyp zu sehen – etwas womit man sich gerne und leicht identifiziert, eine beliebte Gruppenzugehörigkeit. Die Wahrnehmung und Verbreitung von ADHS in Kultur und Gesellschaft sollte auch medial analysiert werden, doch das muss scharfsinnig und emphatisch geschehen. Denn wenn eine ADHS bei vielen Betroffenen, zumeist Frauen, erst im Erwachsenenalter erkannt wird, und dies nur nach einem langen Weg des Ungewissen und Scham, kann die Diagnose wirklich so populär sein?
Titelbild unter Public Domain:
Der Struwwelpeter: Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug Tafel 2, 1858, Heinrich Hoffmann
Text: CC-BY-SA 3.0