Es ist mittlerweile kein Geheimnis, dass Deutschland im Bereich der Digitalisierung zurückhängt. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist vielen klar geworden, dass eine gut digitalisierte Verwaltung effizient Anliegen bewältigen und Bürger*innen wirklich unterstützen und nicht nur nerven könnte.
Bereits 2017 hatte sich die Bundesregierung mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet einen breiten Katalog an öffentlichen Serviceangeboten online verfügbar zu machen. 575 Dienstleistungen sollten bis zum Jahresende 2022 digitalisiert werden. Über ein Jahr später sind aktuell nur 153 Serviceangebote bundesweit verfügbar. Bei dem derzeitigen Tempo wird es weitere 9 Jahre dauern, bis die Ziele des OZG erreicht sind. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland in der Digitalisierung von verschiedenen Dienstleistungen für Bürger*innen im Mittelfeld auf Platz 13. Bei dem digitalen Angebot für Unternehmen schneidet Deutschland deutlich schlechter ab auf Platz 19.
Grund für das Stagnieren der Digitalisierung der Verwaltungsdienste in Deutschland ist vor allem die fehlende Priorisierung der angestrebten digitalen Transformation. 2017 verpflichtete sich die damalige Bundesregierung im Koalitionsvertrag dazu, die Digitalisierung als eines der wichtigsten Ziele zu definieren und erklärte, an die Spitze Europas kommen zu wollen. Die aktuelle Bundesregierung versprach selbiges und wollte sich dabei besonders auf die Digitalisierung der Verwaltungsdienste fokussieren. Doch es kam leider anders. Das Scheitern der jetzigen Regierung an diesem Vorhaben wird allein darin deutlich, dass zwischen 2018 und 2022 nur knapp die Hälfte der 3,5 Mrd. Euro, die zur Verfügung standen, ausgeschöpft wurden. 2023 gab das Innenministerium dann bekannt, dass die Gelder für die Umsetzung des OZGs um 99% für das Jahr 2024 gekürzt werden sollen, von 377 Mio. Euro im Jahr 2023 zu nur 3,3 Mio. Euro, die der Haushalt 2024 vorsieht. Das OZG soll sich erstmal mit Ausgaberesten finanzieren und bekomme keine neuen Mittel.
Ein weiterer Grund dafür, dass Deutschland im europäischen Vergleich weit zurückliegt, ist, dass es an einer zentralen Verantwortung beim Thema Digitalisierung fehlt. Obwohl der Bund mit dem OZG für ganz Deutschland das Verwaltungsserviceangebot digitalisieren wollte, ist jedes Bundesland bzw. jede Gemeinde selbst für die Umsetzung verantwortlich. Zudem ist auf Grund von verschiedenen Systemen in den Kommunen die Umsetzung von „Best Practice“, sprich der Nutzung der bewährtesten Lösungen für die verschiedenen Institutionen, nur schwer möglich.
Die nächste Baustelle der deutschen digitalen Infrastruktur ist die Vernetzung der verschiedenen Dienstleistungen und Register. Notwendig wäre ein ähnliches System wie das in Estland bestehende X-Road. Die X-Road ist ein verschlüsseltes Netzwerk zur Datenübertragung, welches verschiedene Dienstleistungen miteinander verknüpft. So können z.B. Daten aus dem Bürgerkonto einfach und verschlüsselt von der Krankenkasse abgerufen werden und müssen nicht erneut eingetragen werden. Ähnliche Vorhaben sind in Deutschland meist auf Grund von Datenschutzbedenken oder Brüchen bestehender Datenschutzgesetze gescheitert, was für viel Frustration bei Bürger*innen sorgt.
Lösungsansätze für die oben skizzierten Probleme gibt es mittlerweile zu genüge. Das im Februar 2024 verabschiedete Onlinezugangsgesetz 2.0 soll den Fortschritt der Digitalisierung deutlich beschleunigen. Durch das OZG 2.0, haben Bürger*innen ab 2028 das Recht auf digitale Verwaltungsleistungen, sofern diese digital umsetzbar sind. Das Gesetz soll Bund und Ländern Druck machen, da ab 2028, Leistungen, die bis dahin nicht digitalisiert sein sollten, vor Gericht eingeklagt werden können.
Das OZG 2.0 soll des weiteren die Nutzung der BundID vereinfachen und somit für eine breitere Akzeptanz und Nutzung der Dienstleistung sorgen, in dem die Identifizierung mit dem ePersonalausweis nur beim ersten Login bei der BundID notwendig ist. Das Problem des OZG, wie des OZG 2.0 ist jedoch, dass lediglich beschlossen wird, dass digitale Dienstleistungen verfügbar sein sollen. Die bereits angesprochene fehlende Zentralisierung bzw. Vereinheitlichung von Dienstleistungen sorgt aber dafür, dass Teile Deutschlands deutlich besser und weiter digitalisiert sind als andere. Pilotprojekte wie etwa E-Akte Bund zeigen, dass eine bundesweite Zusammenarbeit möglich und durchaus notwendig ist. Die Verantwortung bei den einzelnen Bundesländern zu lassen verlangsamt die flächendeckende Digitalisierung ungemein.
Die Regierung arbeitet bereits daran bis 2025 die wichtigsten Register, wie z.B. die Betriebsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit, zu digitalisieren. Dies ist die Grundvoraussetzung um das EU weite Ziel „Once Only“ umzusetzen. “Once Only” sieht vor, dass Daten nur einmal bei staatlichen Stellen gemeldet werden müssen. Aber auch die dafür benötigte bundesweite Vernetzung der Register wird aus Datenschutzgründen schwierig, weshalb das Ziel, bis 2025 die wichtigsten Register zu digitalisieren, schwer einzuhalten ist. Das Einhalten von Regularien und Gesetzen zum Datenschutz spielt bei der Umsetzungsfähigkeit eine große Rolle, es bedarf an mehr Fachpersonal.
Der Ausblick in die digitale Zukunft Deutschlands sieht derzeit nicht gerade rosig aus. Andauernd scheitern diverse Vorhaben an ähnlichen Problemen, gerade Datenschutzbedenken, die aus den verantwortlichen Behörden der einzelnen Bundesländer kommen, führen oft zu Frustration in Digitalisierungsprojekten. Man schiebt sich dann gerne die Schuld gegenseitig zu. Und es mangelt an Fachpersonal in den Ämtern bzw. finden sich immer weniger junge Menschen, die interessiert daran sind sich mit der wichtigen Arbeit, die die Verwaltungsdienste leisten, zu befassen. Fakt ist, es muss eine Lösung her und das möglich schnell. Das OZG 2.0 ist dafür ein guter Ansatz, um den Behörden Druck zu machen. Der wichtigste nächste Schritt ist aber der Ausbau der BundID und dessen Portal, sodass Bürger*innen sich den Gang zum Amt ersparen können. Ebenfalls sollte zukünftig die Verknüpfung der verschiedenen Ämter und Registern mittels einer X-Road ähnlichen Struktur schnellstmöglich angestrebt werden. Es gibt also weiterhin viel zu tun über die nächsten Jahre, um den derzeitigen Zustand der Digitalisierung der Verwaltungsdienste wirklich zu verbessern.
Text: CC-BY-SA 3.0
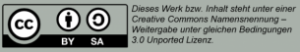
Photo by: Photo by Beatriz Pérez Moya on Unsplash